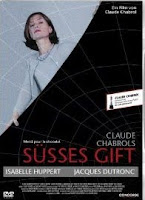Viele Literaturliebhaber verbinden heute mit dem Namen George Gordon Lord Byron (1788 - 1824) vor allem jenen düsteren Helden, dem als auf sich selbst fixierten und verletzlichen Einzelgänger mit künstlerischer Ader Zufriedenheit und Glück versagt bleiben und der als seine Erfindung gilt, weshalb er unter dem Namen “Byronic Hero” Eingang ins Arsenal der “Schwarzen Romantik” fand. Tatsächlich werden aber die Werke, die diesen Archetypus formten und feierten (etwa “closet plays” wie “Manfred”, 1817, oder die einst von den Damen verschlungenen Verserzählungen “The Corsair” und “Lara”, beide 1814) kaum mehr gelesen. - Dass Byron, eine der faszinierendsten Gestalten der englischen Literatur, noch immer als bedeutender Vertreter der Spätromantik gilt, verdankt er vielmehr einer Strophenform, die er auf einzigartige Weise seinen Zwecken dienlich zu machen verstand und mit deren Hilfe ihm ein literarisches Meisterwerk von Weltrang gelang: der “ottava rima” (dt. Stanze).
Lord Byron war ein Mann, der sich schon früh den Ruf erwarb, sowohl ein grosser Dichter als auch eine Gestalt von zweifelhaftem Ruf zu sein: Die ersten beiden Canti seines langen und langatmig romantisierenden Gedichts “Childe Harold’s Pilgrimage” (1812 veröffentlicht), machten ihn über Nacht berühmt und sein Verhältnis zur verheirateten Lady Caroline Lamb, die ihn als “mad, bad, and dangerous to know” bezeichnete, zum "skandalösen" Gesprächsthema der besseren Gesellschaft. Als er sich dann 1815 auch noch in seine Halbschwester Augusta verliebte und 1816 seine Frau Annabella Milbanke - das Ende einer Zweckehe! - verliess, kam es zum Eklat. Byron, der Mann mit dem Klumpfuss, dem auch etliche Verhältnisse zu jungen Männern nachgesagt werden, verliess England endgültig - und erblühte vielleicht erst jetzt zu wahrhaft künstlerischer Grösse, die sich etwa darin zeigte, dass er in Goethe einen Bewunderer fand.
Byron gilt nicht als der eigentliche Entdecker der in der italienischen Dichtung (Bocaccio, Pulci u.a.) seit langem gebräuchlichen Strophenform “ottava rima” für die englische Literatur. Als er, der zügige und hochtalentierte Vielschreiber, sie jedoch für eines seiner Gedichte (“Beppo”, 1818) benutzte, erkannte er sogleich, welche Möglichkeiten sie einem wahrhaften Könner wie ihm bot - und er beschloss, ein “’mock-epic‘-poem”, ein die alten Epen nachahmendes Spottgedicht zu schreiben, das ihn bis zu seinem Lebensende begleiten und dessen Held, wie er schon zu Beginn ankündigte, nur zufällig Don Juan sein sollte:
"I want a hero: an uncommon want,
When every year and month sends forth a new one,
Till, after cloying the gazettes with cant,
The Age discovers he is not the true one:
Of such as these I should not care to vaunt,
I'll therefore take our ancient friend Don Juan -
We all have seen him in the pantomime,
Sent to the devil somewhat ere his time."
(Canto I, 1)
Denn auch wenn wir im meisterhaft geschriebenen “Don Juan” gelegentlich etwas über seinen “Helden”, der hier eher als willenloses Opfer sexgieriger Weiber denn als grosser Verführer dargestellt wird, erfahren, so geht es dem bedeutendsten Egomanen unter den Dichtern doch vor allem darum, sich selber respektive seine Kunstfertigkeit zur Schau zu stellen (es ist im Englischen ausserordentlich schwer, derart viele passende zwei- , ja dreisilbige Reimwörter zu finden und sie erst noch oft spöttisch auf eine Pointe hin einzusetzen) - und gnadenlos über die englische Gesellschaft herzufallen, deren heuchlerische Dekadenz er ständig im Auge behält, wobei nicht zuletzt die Dichter der “älteren” Romantik unter seinem Hohn leiden müssen. Robert Southey, ein mittelmässiger Dichter, den man zum “poeta laureatus” gemacht hatte, bekommt ebenso sein Fett ab wie William Wordsworth, einst Verfechter der Französischen Revolution, jetzt konservativer und moralinsaurer Gefälligkeitslyriker:
"Such names at present cut a convict figure,
The very Botany Bay in moral geography;
Their loyal treason, renegado rigour,
Are good manure for their more bare biography,
Wordsworth's last quarto, by the way, is bigger
Than any since the birthday of typography;
A drowsy frowzy poem call'd the 'Excursion,'
Writ in a manner which is my aversion."
(Canto III, 94)
Gemälde von Ford Madox Brown (1821 - 1893)
Besonders gern packt der Erzähler seine Gesellschaftskritik in die vorgeschobene Geschichte um Don Juan ein. So landet etwa der "Held" nach einem Schiffbruch auf einer Insel, wo er sich in die Tochter eines furchterregenden Seeräubers namens Lambro verliebt, dessen Ähnlichkeit mit der "guten" Gesellschaft aber auf perfide Weise betont wird, um den möglicherweise erschreckten Leser ironisch zu beruhigen:
"You're wrong. - He was the mildest manner'd man
That ever scuttled ship or cut a throat,
With such true breeding of a gentleman,
You never could divine his real thought;
No courtier could, and scarcely woman can
Gird more deceit within a petticoat;
Pity he loved adventurorus life's variety,
He was so great a loss to good society."
(Canto III, 41)
Und wenn dieser Byron vertretende Erzähler darüber nachdenkt, welche grossen Männer, die auf England einen guten Einfluss auszuüben vermochten, nicht mehr am Leben sind oder dem Exil den Vorzug gaben, kann er nur zu einer Schlussfolgerung kommen:
"Nought's permanent among the human race,
Except the Whigs not getting into place."
(Canto XI, 82)
Daneben werden dem Leser natürlich auch die saftigen Liebesabenteuer aufgetischt, in die der arme Don Juan mehr unfreiwillig hineinrutscht. So beobachtet er als erst erblühender Jüngling etwa über mehrere Strophen hinweg unschuldig mit der verheirateten Julia den Sonnenuntergang, während diese innerlich immer mehr ihrer Geilheit verfällt und ihr am Ende nachgibt, was in Worten geschildert wird, die in England noch heute gern zitiert werden:
"A little still she strove, and much repented,
And whispering 'I will ne'er consent' - consented."
(Canto I, 117)
Gemälde von Eugène Delacroix (1798 - 1863)
Die folgende gefährliche Affäre führt dazu, dass Don Juan mit seinem Lehrer Pedrillo das Land verlassen muss, der nach einem Schiffbruch (die Szene wurde vom französischen Romantiker Eugène Delacroix gemalt) von den Überlebenden auf einem Rettungsboot gefressen wird. Seine Liebe zur Tochter des Seeräubers wiederum endet auf einem Sklavenmarkt, wo er alsbald zum Lustknaben einer Sultana avanciert. Nach dem Angriff der Russen auf die Türkei findet er auch Schutz...
"In Catherine's reign, whom glory still adores,
As greatest of all sovereigns and w----s."
(Canto VI, 92)
Im zehnten Canto gelangt Juan endlich nach England, und der Erzähler schildert in drastischen Worten, was für ein in Schmutz und Rauch versinkendes London er eigentlich hätte erblicken müssen (unser naiver Held rühmt indessen den Reichtum des Landes, seine tugendhaften Frauen und sicheren Strassen - um prompt von einem Strassenräuber überfallen zu werden):
"A mighty mass of brick, and smoke, and shipping,
Dirty and dusky, but as wide as eye
Could reach, with here and there a sail just skipping
In sight, then lost amidst the forestry
Of masts; a wilderness of steeples peeping
On tiptoe through their sea-coal canopy;
A huge, dun cupola, like foolscap crown
On a fool's head - and there is London Town."
(Canto X, 82)
 Frech, aufmüpfig legt der Dichter los, dessen erste beiden Canti von "Don Juan" 1819 in England anonym veröffentlicht und natürlich sogleich wegen ihres “unsittlichen Inhalts” gerügt wurden. Er gab auch zu, dass er keine Ahnung hatte, wohin das Schicksal seinen Helden noch verschlagen sollte. Denn es ging ihm wirklich um Selbstdarstellung und um seine Gesellschaftskritik, auf beinahe akrobatisch zu nennende Art bewältigt mit dieser äusserst schwer zu handhabenden Strophenform, die er für sich regelrecht zu "zähmen" vermochte. Sechzehn Canti und ein halbes sollten es werden; vermutlich hätte er sie leicht verdoppelt, wäre er nicht in jungen Jahren im Kampf für die Unabhängigkeit der Griechen an einer Lungenentzüdndung gestorben. - Byron spielte auch auf sein Vorgehen, die Nachahmung italienischer Dichter, die sich im 17. Jahrhundert mündliche Improvisations-Wettkämpfe geliefert hatten, an, verheimlichte aber, wie mühsam diese scheinbare Nachahmung im Englischen sein musste:
Frech, aufmüpfig legt der Dichter los, dessen erste beiden Canti von "Don Juan" 1819 in England anonym veröffentlicht und natürlich sogleich wegen ihres “unsittlichen Inhalts” gerügt wurden. Er gab auch zu, dass er keine Ahnung hatte, wohin das Schicksal seinen Helden noch verschlagen sollte. Denn es ging ihm wirklich um Selbstdarstellung und um seine Gesellschaftskritik, auf beinahe akrobatisch zu nennende Art bewältigt mit dieser äusserst schwer zu handhabenden Strophenform, die er für sich regelrecht zu "zähmen" vermochte. Sechzehn Canti und ein halbes sollten es werden; vermutlich hätte er sie leicht verdoppelt, wäre er nicht in jungen Jahren im Kampf für die Unabhängigkeit der Griechen an einer Lungenentzüdndung gestorben. - Byron spielte auch auf sein Vorgehen, die Nachahmung italienischer Dichter, die sich im 17. Jahrhundert mündliche Improvisations-Wettkämpfe geliefert hatten, an, verheimlichte aber, wie mühsam diese scheinbare Nachahmung im Englischen sein musste:
"A mighty mass of brick, and smoke, and shipping,
Dirty and dusky, but as wide as eye
Could reach, with here and there a sail just skipping
In sight, then lost amidst the forestry
Of masts; a wilderness of steeples peeping
On tiptoe through their sea-coal canopy;
A huge, dun cupola, like foolscap crown
On a fool's head - and there is London Town."
(Canto X, 82)
 Frech, aufmüpfig legt der Dichter los, dessen erste beiden Canti von "Don Juan" 1819 in England anonym veröffentlicht und natürlich sogleich wegen ihres “unsittlichen Inhalts” gerügt wurden. Er gab auch zu, dass er keine Ahnung hatte, wohin das Schicksal seinen Helden noch verschlagen sollte. Denn es ging ihm wirklich um Selbstdarstellung und um seine Gesellschaftskritik, auf beinahe akrobatisch zu nennende Art bewältigt mit dieser äusserst schwer zu handhabenden Strophenform, die er für sich regelrecht zu "zähmen" vermochte. Sechzehn Canti und ein halbes sollten es werden; vermutlich hätte er sie leicht verdoppelt, wäre er nicht in jungen Jahren im Kampf für die Unabhängigkeit der Griechen an einer Lungenentzüdndung gestorben. - Byron spielte auch auf sein Vorgehen, die Nachahmung italienischer Dichter, die sich im 17. Jahrhundert mündliche Improvisations-Wettkämpfe geliefert hatten, an, verheimlichte aber, wie mühsam diese scheinbare Nachahmung im Englischen sein musste:
Frech, aufmüpfig legt der Dichter los, dessen erste beiden Canti von "Don Juan" 1819 in England anonym veröffentlicht und natürlich sogleich wegen ihres “unsittlichen Inhalts” gerügt wurden. Er gab auch zu, dass er keine Ahnung hatte, wohin das Schicksal seinen Helden noch verschlagen sollte. Denn es ging ihm wirklich um Selbstdarstellung und um seine Gesellschaftskritik, auf beinahe akrobatisch zu nennende Art bewältigt mit dieser äusserst schwer zu handhabenden Strophenform, die er für sich regelrecht zu "zähmen" vermochte. Sechzehn Canti und ein halbes sollten es werden; vermutlich hätte er sie leicht verdoppelt, wäre er nicht in jungen Jahren im Kampf für die Unabhängigkeit der Griechen an einer Lungenentzüdndung gestorben. - Byron spielte auch auf sein Vorgehen, die Nachahmung italienischer Dichter, die sich im 17. Jahrhundert mündliche Improvisations-Wettkämpfe geliefert hatten, an, verheimlichte aber, wie mühsam diese scheinbare Nachahmung im Englischen sein musste:"I rattle on exactly as I'd talk
With anybody in a ride or walk.
I don't know that there may be much ability
Shown in this sort of desultory rhyme;
But there's a conversational facility
Which may round off an hour upon a time,
Of this I'm sure at least, there's no servility
In my irregularity of chime,
Which rings what's uppermost of new or hoary,
Just as I feel the Improvvisatore."
(Canto XV, 19 - 20)
Byron wurde es nicht müde, mit seinem geliebten Werkzeug, der “ottava rima”, die herrlichsten Kapriolen anzustellen, vom “Romantizismus” wegzukommen und zu einem der grössten Satiriker aller Zeiten aufzusteigen. Sein Meisterwerk “Don Juan” mag lang sein, vielen zu lang. Aber es ist immer mal wieder eine - möglichst gut kommentierte! - Lektüre wert, lehrt uns allerlei über das ausgehende 18. und frühe 19. Jahrhundert - und weicht keiner Gelegenheit zum Spott aus. Während Shelley, mit dem der Dichter befreundet war, nach einiger Zeit eher “abgehobene” Werke schrieb und uns der jung verstorbene John Keats vor allem wegen seiner wenigen Gedichte in Erinnerung bleibt (die Balladen trugen auch ihren Anteil zur “Schwarzen” Romantik bei), war Lord Byron unter den Dichtern der Spätromantik derjenige mit der - boshaften - Bodenhaftung. Ein wahrhafter Genuss!
******
Kaum jemand dürfte gerade diesem Eintrag aufmerksam gefolgt sein. Wer den Anfang las und jetzt nach den Sternchen noch einmal einsetzte, wird vermuten, meine Besprechung von Byron's Meisterwerk sei als Vorbereitung auf Ken Russells “Gothic” (1986) zu verstehen. - Wenn ihr euch da mal nicht irrt!