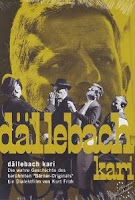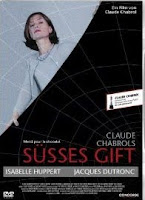(Glauser, Schweiz 2011)
Regie: Christoph Kühn
Der Dokumentarfilm galt lange Zeit als eine Kernkompetenz im Schweizer Filmschaffen. Er war billiger als die im Ausland ohnehin nie sonderlich erfolgreichen Spielfilme, und der Bund zog es, was weltweit einmalig war, vor, ihm einen Grossteil seiner Filmförderungsgelder zukommen zu lassen. Internationale Beachtung war die Folge; es entstanden bis in die Mitte dieses Jahrtausends hinein zum Teil in Zusammenarbeit mit anderen Nationen Perlen, von denen hier nur drei genannt seien: Christian Freis "War Photographer" (2001), für einen Oscar nominiert, "Elisabeth Kübler-Ross - Dem Tod ins Gesicht sehen" (2003) von Stefan Haupt und "Skinhead Attitude" (2003) unter der Regie von Daniel Schweizer. - Doch bereits 2005 sprachen Schweizer Dokumentarfilmer in einem Aufruf von einem Alarmzustand: Die Senkung der Kosten für Spielfilme und die Tendenz in Richtung Fernsehproduktionen verführten die Geldgeber einerseits zur Abkehr vom "Cinéma du réel"; andererseits standen immer mehr - talentierte - Dokumentarfilmer an und wollten auch ihre Projekte verwirklichen. Subventionen für das Genre wurden gekürzt, und es entstanden nur noch kleine, mit etwas Glück kurze Zeit in den Kinos einzelner Schweizer Städte laufende Dokumentarfilme, die kaum Aufsehen erregten und nach einer Fernsehausstrahlung vielleicht von wenigen Interessierten als kostspielige (!) DVD gekauft wurden. Von internationaler Ausstrahlung konnte keine Rede mehr sein, da sie sich aus Kostengründen vor allem Themen annehmen mussten, die nur für die Schweiz, oft sogar nur für eine bestimmte Region von Interesse waren.
Der Zuger Filmer Christoph Kühn erweckt den Eindruck, er habe mit seinen
Dokumentarfilmen, die sich ausschliesslich aussergewöhnlicher Figuren der
Schweizer Geschichte annehmen, gar nie internationales Ansehen angestrebt.
Zu wenig „ambitioniert“ wirken auf den ersten Blick die – spannenden - Versuche, sich in die von ihm gezeichneten
Gestalten hineinzuversetzen, aber auch Zeitgenossen und Experten zur Sprache
kommen zu lassen – eher fürs Fernsehen als für eine Kinoauswertung gemacht,
die für Furore sorgen würde. Berühmt wurde 1985 sein „FRS – Das Kino der
Nation“, ein filmischer Essay über den Schweizer Regisseur Franz Schnyder, der
von mir an anderer Stelle „gewürdigt“ wurde. 1993 folgte eine
Auseinandersetzung mit der Vielfältigkeit der Schweizer Künstlerin Sophie
Taeuber-Arp – und 2007 eine Dokumentation über den Umweltaktivisten Bruno
Manser, der mit seinen Vorträgen über das Schicksal der Urvölker des
Regenwaldes von sich reden machte und seit dem Jahr 2000 als im indonesischen Teil
Borneos verschollen gilt.
Im Januar dieses Jahres gelangte nun Kühns Dokumentarfilm über den
Schweizer Schriftsteller Friedrich Glauser in wenige Kinos vor allem der Region
Bern. Glauser ist als Vater des Schweizer Kriminalromans und als Vorläufer des (modernen) deutschen Krimis überhaupt in die Geschichte eingegangen. Seine erst in den
letzten drei Lebensjahren entstandenen und zum Teil mehrfach verfilmten Werke „Wachtmeister
Studer“, „Matto regiert“ und „Der Chinese“ haben in der Literaturgeschichte mittlerweile
ihren festen Platz. Der Untertitel von Kühns Dokumentation „Das
bewegte Leben des grossen Schriftstellers“ lässt aber erkennen, dass der Film
weniger am Werk als am „Irrenhäusler“, am „Morphinisten“, der hinter ihm steht,
interessiert ist.
Der Film beginnt im Irrenhaus Münsingen, wo der ein Leben lang vor der Bürgerlichkeit und dem harten Vater fliehende Dadaist, Fremdenlegionär und Schriftsteller in einer Nacht des Jahres 1934 über sein Leben nachdenkt. Eine Stimme aus dem Off, die den Zuschauer 75 Minuten lang begleitet, zitiert aus dem Nachlass Glausers, der reichhaltiger ist, als oft angenommen wird, und der uns ein Leben im Fieberrausch zwischen Rebellion und Resignation vermittelt. Fiktive Szenen bieten Einblicke in die Kindheit des Schriftstellers, der sowohl zum Opfer seines Vaters (dieser liess ihn entmündigen und in eine Klinik einweisen, wo man fälschlicherweise Schizophrenie diagnostizierte) als auch seiner eigenen ständigen Unrast werden sollte. Der Stimme folgend entwickelt sich der Film zum ruhelosen, rauschhaften Mosaik, wechselnd zwischen Schriftdokumenten, Photos, Aufnahmen ehemaliger Aufenthaltsorte und Archivaufnahmen. Eine dem Wesen dieser irrenden, ständig die Brücke von der Anstalt und der Welt da draussen suchenden Stimme ("Ich bin von einer Mürbe, die bei einer Linzertorte vielleicht als Qualität aufgefasst werden kann") gerecht werdende Bereicherung bilden die mehr schwarzen als weissen Zeichnungen von Hannes Binder, der schon mehrere Romane Glausers illustriert hatte. --- Daneben stehen geradezu bieder wirkende Interviews mit dem Literaturkritiker und Glauser-Spezialisten Hardy Ruoss oder der anrührenden Lebensgefährtin Berthe Bendel, die er als Pflegerin in Münsingen kennengelernt hatte und die später dem Schweizer Fernsehen erzählen sollte, wie es nach Glausers Entlassung mit ihnen weiterging: ein ruheloses Leben zwischen Atlantik und Mittelmeer – und dann sein Tod unmittelbar vor der geplanten Hochzeit.
Der Film beginnt im Irrenhaus Münsingen, wo der ein Leben lang vor der Bürgerlichkeit und dem harten Vater fliehende Dadaist, Fremdenlegionär und Schriftsteller in einer Nacht des Jahres 1934 über sein Leben nachdenkt. Eine Stimme aus dem Off, die den Zuschauer 75 Minuten lang begleitet, zitiert aus dem Nachlass Glausers, der reichhaltiger ist, als oft angenommen wird, und der uns ein Leben im Fieberrausch zwischen Rebellion und Resignation vermittelt. Fiktive Szenen bieten Einblicke in die Kindheit des Schriftstellers, der sowohl zum Opfer seines Vaters (dieser liess ihn entmündigen und in eine Klinik einweisen, wo man fälschlicherweise Schizophrenie diagnostizierte) als auch seiner eigenen ständigen Unrast werden sollte. Der Stimme folgend entwickelt sich der Film zum ruhelosen, rauschhaften Mosaik, wechselnd zwischen Schriftdokumenten, Photos, Aufnahmen ehemaliger Aufenthaltsorte und Archivaufnahmen. Eine dem Wesen dieser irrenden, ständig die Brücke von der Anstalt und der Welt da draussen suchenden Stimme ("Ich bin von einer Mürbe, die bei einer Linzertorte vielleicht als Qualität aufgefasst werden kann") gerecht werdende Bereicherung bilden die mehr schwarzen als weissen Zeichnungen von Hannes Binder, der schon mehrere Romane Glausers illustriert hatte. --- Daneben stehen geradezu bieder wirkende Interviews mit dem Literaturkritiker und Glauser-Spezialisten Hardy Ruoss oder der anrührenden Lebensgefährtin Berthe Bendel, die er als Pflegerin in Münsingen kennengelernt hatte und die später dem Schweizer Fernsehen erzählen sollte, wie es nach Glausers Entlassung mit ihnen weiterging: ein ruheloses Leben zwischen Atlantik und Mittelmeer – und dann sein Tod unmittelbar vor der geplanten Hochzeit.
Kühns Film wurde nicht von allen Kritikern geschätzt. Man
vermisste wohl eine eingehendere Beschäftigung mit dem literarischen
Werk Glausers, zeigte sich auch etwas irritiert wegen der Mischung aus Biederkeit
und Wahn – obwohl gerade diese Mischung das Leben des Schriftstellers, der von
seinem ehemaligen Psychiater als „pfiffig und verschmitzt, aber auch verwundbar“
charakterisiert wurde, ausmachte. – Ich möchte mir nach einer einmaligen
Sichtung kein abschliessendes Urteil erlauben, muss aber betonen, dass ich nicht
nur viel über den Menschen Friedrich Glauser erfahren habe, sondern von der Art, wie man sich diesem näherte, gepackt war. Ich hoffe
vor allem, der Dokumentarfilm werde nach seiner zu erwartenden Fernsehausstrahlung einmal auf
einer DVD erhältlich sein, die auch den Ansprüchen deutscher Käufer genügt
(Untertitelung des Interviews mit Bendel etc.). Denn Glauser ist nicht nur
Bestandteil der Schweizer Literatur, er gehört zu den bedeutenden
deutschsprachigen Schriftstellern seiner Zeit – und Kühn hat mit dem
dokumentarischen Essay über sein Leben zu einem Thema gefunden, das weit über
die Schweiz hinaus auszustrahlen verdient.